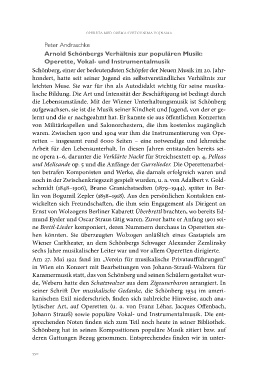Page 552 - Weiss, Jernej, ur./ed. 2021. Opereta med obema svetovnima vojnama ▪︎ Operetta between the Two World Wars. Koper/Ljubljana: Založba Univerze na Primorskem in Festival Ljubljana. Studia musicologica Labacensia, 5
P. 552
opereta med obema svetovnima vojnama
Peter Andraschke
Arnold Schönbergs Verhältnis zur populären Musik:
Operette, Vokal- und Instrumentalmusik
Schönberg, einer der bedeutendsten Schöpfer der Neuen Musik im 20. Jahr-
hundert, hatte seit seiner Jugend ein selbstverständliches Verhältnis zur
leichten Muse. Sie war für ihn als Autodidakt wichtig für seine musika-
lische Bildung. Die Art und Intensität der Beschäftigung ist bedingt durch
die Lebensumstände. Mit der Wiener Unterhaltungsmusik ist Schönberg
aufgewachsen, sie ist die Musik seiner Kindheit und Jugend, von der er ge-
lernt und die er nachgeahmt hat. Er kannte sie aus öffentlichen Konzerten
von Militärkapellen und Salonorchestern, die ihm kostenlos zugänglich
waren. Zwischen 1900 und 1904 war ihm die Instrumentierung von Ope-
retten – insgesamt rund 6000 Seiten – eine notwendige und lehrreiche
Arbeit für den Lebensunterhalt. In diesen Jahren entstanden bereits sei-
ne opera 1–6, darunter die Verklärte Nacht für Streichsextett op. 4, Pelleas
und Melisande op. 5 und die Anfänge der Gurrelieder. Die Operettenarbei-
ten betrafen Komponisten und Werke, die damals erfolgreich waren und
noch in der Zwischenkriegszeit gespielt wurden, u. a. von Adalbert v. Gold-
schmidt (1848–1906), Bruno Granichstaedten (1879–1944), später in Ber-
lin von Bogumil Zepler (1858–1918). Aus den persönlichen Kontakten ent-
wickelten sich Freundschaften, die ihm sein Engagement als Dirigent an
Ernst von Wolzogens Berliner Kabarett Überbrettl brachten, wo bereits Ed-
mund Eysler und Oscar Straus tätig waren. Zuvor hatte er Anfang 1901 sei-
ne Brettl-Lieder komponiert, deren Nummern durchaus in Operetten ste-
hen könnten. Sie überzeugten Wolzogen anläßlich eines Gastspiels am
Wiener Carltheater, an dem Schönbergs Schwager Alexander Zemlinsky
sechs Jahre musikalischer Leiter war und vor allem Operetten dirigierte.
Am 27. Mai 1921 fand im „Verein für musikalische Privataufführungen“
in Wien ein Konzert mit Bearbeitungen von Johann-Strauß-Walzern für
Kammermusik statt, das von Schönberg und seinen Schülern gestaltet wur-
de, Webern hatte den Schatzwalzer aus dem Zigeunerbaron arrangiert. In
seiner Schrift Der musikalische Gedanke, die Schönberg 1934 im ameri-
kanischen Exil niederschrieb, finden sich zahlreiche Hinweise, auch ana-
lytischer Art, auf Operetten (u. a. von Franz Léhar, Jacques Offenbach,
Johann Strauß) sowie populäre Vokal- und Instrumentalmusik. Die ent-
sprechenden Noten finden sich zum Teil noch heute in seiner Bibliothek.
Schönberg hat in seinen Kompositionen populäre Musik zitiert bzw. auf
deren Gattungen Bezug genommen. Entsprechendes finden wir in unter-
550
Peter Andraschke
Arnold Schönbergs Verhältnis zur populären Musik:
Operette, Vokal- und Instrumentalmusik
Schönberg, einer der bedeutendsten Schöpfer der Neuen Musik im 20. Jahr-
hundert, hatte seit seiner Jugend ein selbstverständliches Verhältnis zur
leichten Muse. Sie war für ihn als Autodidakt wichtig für seine musika-
lische Bildung. Die Art und Intensität der Beschäftigung ist bedingt durch
die Lebensumstände. Mit der Wiener Unterhaltungsmusik ist Schönberg
aufgewachsen, sie ist die Musik seiner Kindheit und Jugend, von der er ge-
lernt und die er nachgeahmt hat. Er kannte sie aus öffentlichen Konzerten
von Militärkapellen und Salonorchestern, die ihm kostenlos zugänglich
waren. Zwischen 1900 und 1904 war ihm die Instrumentierung von Ope-
retten – insgesamt rund 6000 Seiten – eine notwendige und lehrreiche
Arbeit für den Lebensunterhalt. In diesen Jahren entstanden bereits sei-
ne opera 1–6, darunter die Verklärte Nacht für Streichsextett op. 4, Pelleas
und Melisande op. 5 und die Anfänge der Gurrelieder. Die Operettenarbei-
ten betrafen Komponisten und Werke, die damals erfolgreich waren und
noch in der Zwischenkriegszeit gespielt wurden, u. a. von Adalbert v. Gold-
schmidt (1848–1906), Bruno Granichstaedten (1879–1944), später in Ber-
lin von Bogumil Zepler (1858–1918). Aus den persönlichen Kontakten ent-
wickelten sich Freundschaften, die ihm sein Engagement als Dirigent an
Ernst von Wolzogens Berliner Kabarett Überbrettl brachten, wo bereits Ed-
mund Eysler und Oscar Straus tätig waren. Zuvor hatte er Anfang 1901 sei-
ne Brettl-Lieder komponiert, deren Nummern durchaus in Operetten ste-
hen könnten. Sie überzeugten Wolzogen anläßlich eines Gastspiels am
Wiener Carltheater, an dem Schönbergs Schwager Alexander Zemlinsky
sechs Jahre musikalischer Leiter war und vor allem Operetten dirigierte.
Am 27. Mai 1921 fand im „Verein für musikalische Privataufführungen“
in Wien ein Konzert mit Bearbeitungen von Johann-Strauß-Walzern für
Kammermusik statt, das von Schönberg und seinen Schülern gestaltet wur-
de, Webern hatte den Schatzwalzer aus dem Zigeunerbaron arrangiert. In
seiner Schrift Der musikalische Gedanke, die Schönberg 1934 im ameri-
kanischen Exil niederschrieb, finden sich zahlreiche Hinweise, auch ana-
lytischer Art, auf Operetten (u. a. von Franz Léhar, Jacques Offenbach,
Johann Strauß) sowie populäre Vokal- und Instrumentalmusik. Die ent-
sprechenden Noten finden sich zum Teil noch heute in seiner Bibliothek.
Schönberg hat in seinen Kompositionen populäre Musik zitiert bzw. auf
deren Gattungen Bezug genommen. Entsprechendes finden wir in unter-
550